Verschenke ein Stück Zeitgeschichte!
Schenke eine echte alte Zeitung vom Tag der Geburt oder Hochzeit.
Original-Zeitung ab 39,90 € (Preis variiert nach Datum und Titel)So einfach geht's:
- Datum eingeben und passende Zeitung auswählen
- Geschenkmappe aussuchen und Geschenkurkunde gestalten
- Versandadresse angeben und Zahlungswunsch wählen
Bestellung absenden und auf die Geschenkzeitung freuen!
Persönliche Beratung wird bei uns großgeschrieben! Zögere nicht uns anzurufen — wir sind gerne persönlich für Dich da unter 0202 - 64 65 63

Unser Versprechen
Du profitierst von
- fast 30 Jahren Erfahrung
- unserem eigenen Archiv
- unserem gut ausgebildeten und freundlichen Team
Dies bestätigen mehr als 1.000 positive Bewertungen pro Jahr.
Mit Echtheitszertifikat
Unsere Zeitungen sind zu 100 % Original — Kein Nachdruck, keine Kopie.
Individuelles Geschenk
Auf Wunsch mit persönlicher Geschenkurkunde in einer geschmackvollen Geschenkmappe.
Schnelle Lieferung
Alle Zeitungen im eigenen Archiv sind sofort verfügbar und versandfertig.
Rechnungskauf
Bezahle erst nach Erhalt Deiner Bestellung.
Suche jetzt Deine Wunschzeitung in unserem Archiv aus:
Original-Zeitung ab 39,90 € (Preis variiert nach Datum und Titel)24-Stunden-Versand möglich!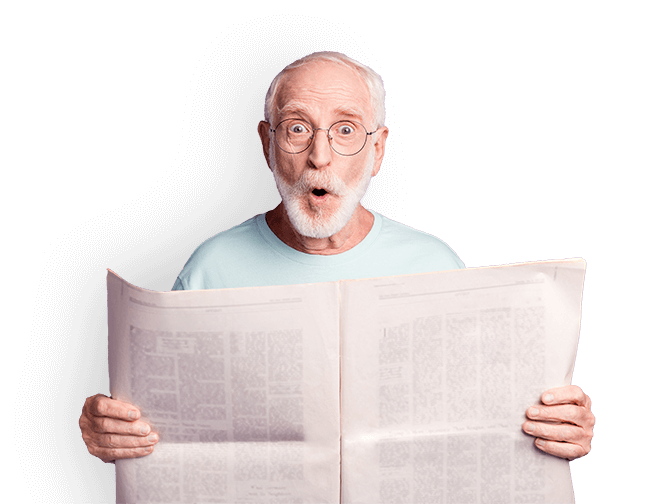
Tolle Geschenkemappe mit alter Zeitung und Zertifikat. Alles reibungslos verlaufen. Schneller Versand. Von mir ein „sehr gut“.